Der Änderungsantrag ist entstanden, da Tübingen (danke Jacob und Hanna) aufgefallen ist, dass ich (Iris) wohl einen vollkommenen Gedankenfurz beim Schreiben des Antrags hatte. Daher haben wir, Jan und Iris, das Thema nochmal neu aufgerollt und einen sinnvolleren Abschnitt zum Thema formuliert.
Erörterung zur Errechnung der KapVO:
Die Hochschulen dürften formal qualifizierte Bewerber*innen also nur abweisen, wenn die Lehrkapazitäten komplett ausgeschöpft sind. Berechnet werden die Kapazitäten „auf der Grundlage des Lehrangebots, des Ausbildungsaufwands und weiterer kapazitätsbestimmender Kriterien“ (Staatsvertrag[1] Art. 6 Abs. 3). Das Lehrangebot ergibt sich vor allem aus dem kumulierten Lehrdeputat des wissenschaftlichen Personals (einschließlich z. B. aller Lehraufträge und Deputatsreduktionen). Der Ausbildungsaufwand (Curricularnormwert, kurz: CNW) gibt den Lehr- und Betreuungsaufwand an, der einer*m Studenten*in in einem bestimmten Fach zusteht, und variiert damit von Fach zu Fach. Sowohl das Lehrdeputat des wissenschaftlichen Personals getrennt nach Personalgruppen (z. B. Professor*innen, wissenschaftliche Mitarbeiter*innen, Doktorand*innen etc.) als auch der Ausbildungsaufwand pro Student*in werden von jedem Bundesland rechtlich geregelt (in den Lehrverpflichtungsverordnungen bzw. den KapVO) und sind sonst somit politische / demokratisch festgelegte Werte. Zu den „weiteren“ Kriterien zählen unter anderem räumliche und sächliche Gegebenheiten, die Ausstattung mit wissenschaftsunterstützendem Personal, der Anteil der Studienabbrüche und in der Medizin auch eine ausreichende Zahl von für die Lehre geeigneten Patient*innen. Aus allen Parametern zusammen wird für jeden einzelnen Studiengang die Anzahl an Studienplätzen errechnet, die pro Jahr maximal für neue Anfänger*innen zur Verfügung stehen.
Das führt dazu, dass die Länder einerseits mehr Studienplätze einrichten können, indem sie ihren Hochschulen mehr Geld geben, damit diese mehr Personal einstellen können, welches Lehrveranstaltungen gibt. Oder sie können neue Studienplätze sozusagen „errechnen“, indem sie die Einflussgrößen der Kapazitätsberechnung ändern – z.B. indem sie die Lehrverpflichtungen verschiedener Personalkategorien erhöhen und den Wert für den Ausbildungsaufwand pro Student*in in einem Fach absenken.
[1] Abrufbar unter: https://www.revosax.sachsen.de/vorschrift/18333-StV-Hochschulzulassung
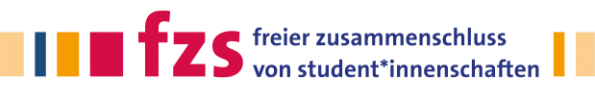
Kommentare